Buchtipps von Uli Rothfuss. | über den Roman„Stammzellen“ von Alina Lindermuth
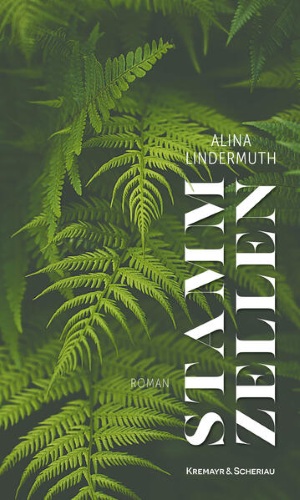
Es ist ein Buch, dass sich nicht sofort und auch im Lesen nicht leicht erschließt. Das man auch nicht in einem Zug durchlesen kann; warum? Weil es mit-nimmt, nicht in einen Sog der Spannung, sondern in Bezüge, die wir aus unserem eigenen Leben, aus unserer Erfahrung ziehen, die wir herübertransferieren in unsere Erfahrung mit diesem Roman; die manches mal Aha-Erlebnisse sein können, oft aber auch uns schmerzhaft verdeutlichen, wie sehr das Leben im Buch und das eigene auf Kippen stehen, auf der Kippe hin zu Abgründen.
Alina Lindermuth, relativ junge Autorin, mit bereits sehr ambitionierten Büchern, schon gut ausgezeichnet, hat hier eine Dystopie geschrieben, hervorragend recherchiert und doch spannend, kraftvoll erzählt, die verstört – und doch wieder nicht, nimmt sie doch, nicht zitierend, aber in Parallelitäten und Anspielungen, auf die zurückliegende Pandemie Rückbindung, und von da klingt manches an, das eigenem Erleben nahe kommt.
Am Leben der jungen Ärztin Ronja, die in einem relativen abgeschiedenen Alpenstädtchen lebt, wird die Geschichte um sie, die Liebesgeschichte zum jungen Sprachforscher, ihr Selbständigwerden im ausgebauten Häuschen, ihre kleine Familie, illustriert, eingebunden in das Weltgeschehen, in das sich ausbreitende Phänomen, dass Menschen sich sukzessive in Bäume verwandeln – Dendrosen heißt es bei ihr, und zunächst weiß niemand, warum und woher das kommt, warum es in manchen Weltregionen häufiger, in anderen weniger häufig auftritt.
Sehr realistisch führt die Autorin den Leser an diese Entwicklung heran, auch anhand persönlicher Schicksale, und als das Kleinkind der Protagonistin eine solche Entwicklung nimmt, der Umgang der jungen Familie und des Umfelds damit in allen Details beschrieben wird, ist die Auswirkung ganz nah, wie unter einem Brennglas, bis hin zur Verpflanzung des Baumes im Garten. Weltweite Verwerfungen werden mit eingefügt, auch was hindert, eine Strategie gegen die Ausbreitung zu finden, Strafzölle zwischen Staaten und als Antwort Zurückhaltung von Daten, nationale Egoismen, die wichtiger als die Rettung von Menschen scheinen, all das erinnert uns an die zurückliegende Pandemie. Aber die Autorin vermittelt auch ein Stück Hoffnung – dass mit moderner Technologie doch Ursachen aufgespürt werden – die in der menschengemachten Umweltbeeinflussung liegen, im massenhaften Zunehmen der Feinstaubbelastung, die Organismen verändern, die Natur zu Gegenstrategien veranlassen; dass nun auch Gegenmaßnahmen ergriffen werden, radikal, um diese Belastungen zu vermindern, bis hin dazu, dass die pandemische Verbreitung zurückgeht. Die persönliche Hoffnung für unsere Ärztin ist, dass sie an dieser Schwelle zu ihrer persönlichen Findungsreise mit dem Fahrrad nach Usbekistan aufbricht. Ja, selbst so kleine Schimmer können Hoffnung geben, noch in die Zukunft blicken zu können.
Es ist kein Horrorbuch, kein deprimierender Roman, im Gegenteil; es ist ein geschickt aufgebautes Erzählstück, das den Leser mitnimmt in eine mögliche künftige Welt, in der weiter gelacht, geweint, geliebt, gehofft wird. In der auch im düsteren Moment noch Hoffnung gesucht wird. Sehr anschaulich, sehr bildhaft, sehr mit literarischer Kraft erzählt, ein Buch, das nach vorne blickt, das nicht Schönwetter predigt, sondern die menschlichen Stärken auch des Festhaltens an Austausch und gegenseitiger Stärkung einbindet und so den Leser in eine Welt entlässt, für die nicht jede Hoffnung verloren zu gehen scheint.
Alina Lindermuth: Stammzellen. Kremayr u. Sheriau. Roman, geb., 312 S. Wien 2025, 25 €.